Das Interview ist Teil der begleitenden Blog-Reihe zur Intervention Rethinking Stadtgeschichte: Perspektiven jüdischer Geschichten und Gegenwarten in der Dauerausstellung des Stadtmuseums Dresden 2021/2022. Angesichts der aktuellen Überlegungen zu einem Jüdischen Museum für Sachsen kommen an dieser Stelle Akteurinnen und Akteure, die sich mit dem Thema beschäftigen, Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinden in Sachsen, von Politik und Gesellschaft sowie Expertinnen und Experten mit ihren Standpunkten, Ideen, Kritiken und Perspektiven zu Wort.
Zur Einführung in die aktuelle Museumsdebatte

Zur Person:
Uwe Hirschfeld hat nach dem Studium in Bielefeld und Kassel ab 1992 an der Evangelischen Hochschule Dresden mit dem Schwerpunkt „Politische Theorie und Bildung“ gearbeitet; seit 2020 ist er in Rente und freiberuflich in den Bereichen Fotografie und politisch-kultureller Bildung engagiert.
(1) Was halten Sie von der Idee, ein „jüdisches Museum“ in Sachsen einzurichten?
Wenn es nicht darum geht, mal wieder die dominanten Sichtweisen des kulturellen Gedächtnisses zu verwahren und einschüchternd zu präsentieren, sondern um einen Lernort lebendigen Austauschs über Gegenwart und Geschichte, kann es nicht genug Museen geben. Das gilt insbesondere für Themen, die in der öffentlichen Wahrnehmung unterrepräsentiert sind. Also lautet meine Antwort erstmal: eine gute Idee.
(2) Wo und wie sollte jüdische Geschichte und Gegenwart zugänglich gemacht werden?
Nun wird es schwieriger. Der erste Teil der Frage erheischt eine simple Antwort nach dem Muster „in XYZ“ und legt damit eine falsche Fährte. Jüdische Geschichte zugänglich zu machen, sollte nicht auf einen Ort begrenzt werden, heißt das doch zugleich: an anderen Orten nicht. Wenn deutsch-jüdische Geschichte mich etwas lehrt, dann, dass Exklusion nicht nur ein falscher Weg, sondern die falsche Richtung ist. Um jüdische Geschichte überall zugänglich zu machen, bedarf es organisatorischer, medialer und räumlicher Innovationen, die über die konventionellen Vorstellungen von Museum hinausgehen. Vielleicht lässt sich etwas aus einem Projekt der Alternativbewegung der 1970er- und 1980er-Jahre lernen: den reisenden Klassenzimmern, bzw. der reisenden Hochschule. Also warum kein mobiles Museum? Wo die Garage steht, ist dann zweitrangig. Natürlich muss man sich das heute nicht mehr mit alten und stinkenden Schulbussen vorstellen, aber die Idee, aufsuchend Geschichte zu thematisieren, wäre vielleicht einen intensiveren Gedanken wert. Zumal die technischen Möglichkeiten heute Perspektiven eröffnen, an die vor fünfzig Jahren nicht zu denken war. Und es gibt ja – darauf hat mich freundlicherweise Solvejg Höppner hingewiesen – auch einige wenige Versuche in die Richtung, etwa das on.tour-Projekt des Jüdischen Museums Berlin.
Ich würde es mir etwas behäbiger vorstellen, vielleicht mobile Container, die alle zwei Jahre ihren Standort wechseln. Da hätte man genug Zeit, um vor Ort aktiv zu werden, ohne in Hektik zu verfallen. Ohnehin ist bei aller sinnvollen Ausstattung, die man sich da wünschen und gebrauchen kann (über Internet-Plattformen bis zu mobilen Bauten), stets im Blick zu behalten, dass meines Erachtens die personelle Ausstattung immer das wichtigste sein wird: qualifizierte und engagierte Mitarbeiter:innen, die mit Menschen ins Gespräch kommen wollen und daher erstmal bereit sind, zu ihnen zu kommen und zuzuhören.
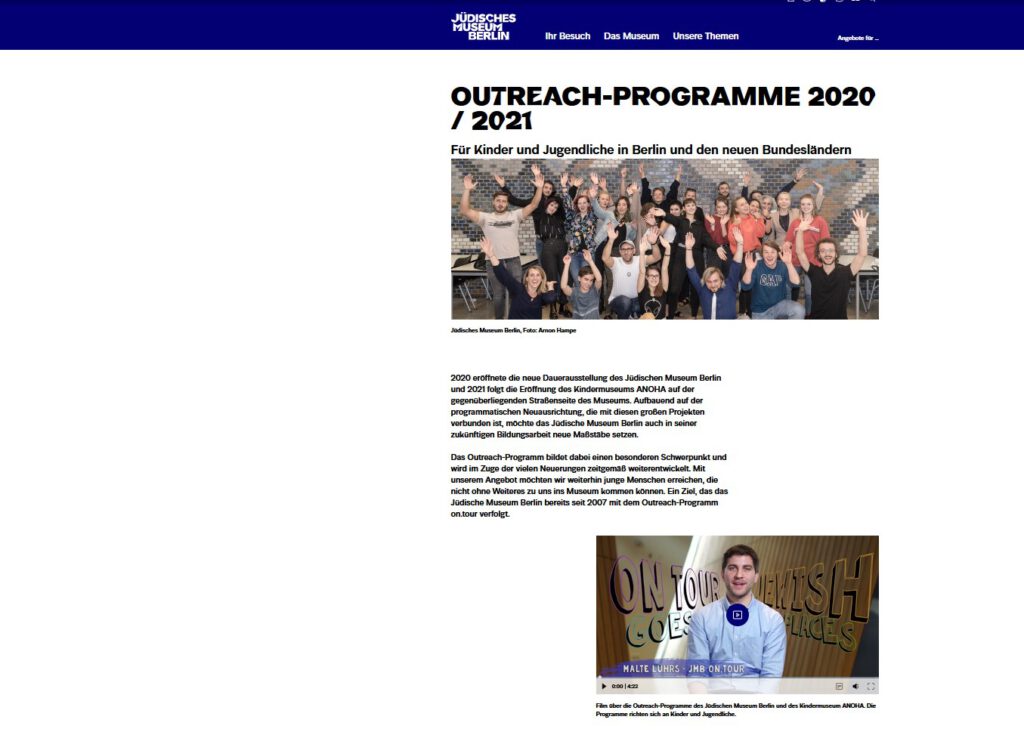
(3) Was kann und was sollte präsentiert werden?
Das, was man findet. Klar, diese Antwort ist für Kurator:innen unbefriedigend. Aber genau das wäre der Charme der Sache: Vor Ort nach Artefakten des Alltags und der Geschichte zu suchen, die im Kontext der lokalen Selbstverständigung „präsentabel“ werden. Das wäre doch wenigstens mal ein paar dutzend Versuche wert … .
(4) Wer soll erreicht werden?
Alle. Punkt. Und nach einer längeren Pause: alle interessierten Menschen. Wer das ist, hängt von der Ansprache ab, von lokalen Diskursen, von guten und schlechten Lehrer:innen, von Straßennamen und den Jahreszeiten. Um alle zu erreichen, braucht es halt ein wenig Geduld.
(5) Wenn Sie ein museales Objekt auswählen könnten, das Sie als besonders aussagekräftig für Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens halten, welches wäre das – und warum?
Einen Ausweis, eine Scheck- oder Eintrittskarte, ausgestellt auf den Namen „Erika Mustermann“. Dies erscheint mir besonders aussagekräftig, weil es nichtssagend ist. Jüdisches Leben unterscheidet sich nicht grundsätzlich von anderem Leben in diesem Land, egal, welche Attribute man aufruft: bayerisch, katholisch, ländlich, urban, muslimisch, sorbisch. Erstmal stehen unsere geteilten Lebensbedingungen im Vordergrund, das haben wir gemeinsam, alle zusammen. Und ob einer ein Kreuz an der Wand hat oder eine Mesusa am Türrahmen, ob Kaffee oder Tee getrunken wird, ob die Küche koscher ist oder im Ramadan gefastet wird, nimmt dieser Gemeinsamkeit nichts. Die, die Unterschiede groß machen, machen die Unterschiede, die dann immer gravierender werden und letztlich rassistisch die Welt aufteilen. Und das wäre denn auch aus der Geschichte der jüdischen Menschen in Deutschland zu lernen: Sie waren nicht anders als andere, sie wurden anders gemacht, um sie zu schikanieren, zu vertreiben, zu vernichten. Gerade dann, wenn wir uns in einem (mobilen!) Museum auch mit der Shoah befassen wollen und müssen, gilt es aufzupassen, dass wir nicht nochmals auf die Unterschiedemacher hereinfallen.

(6) Was sollte in der Debatte um ein Jüdisches Museum als nächstes passieren?
Keine Ahnung.



